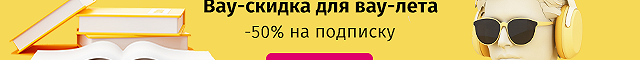
Ich wünsche mir jeden Abend, mein Vater wäre niemals abgereist, hätte sich nicht freiwillig für den Krieg gemeldet. Es war von Anfang an ein dummer Krieg. Ich habe nie wirklich verstanden, wie alles begann, und ich habe immer noch keine Ahnung. Mein Vater hat es mir erklärt, mehrfach, aber ich habe es nicht verstanden. Wahrscheinlich war ich noch zu jung. Vielleicht war ich einfach noch nicht alt genug, um zu wissen, was für sinnlose Dinge Erwachsene sich gegenseitig antun können.
So, wie mein Vater es erklärte, war es ein zweiter Amerikanischer Bürgerkrieg – dieses Mal aber nicht zwischen dem Norden und dem Süden, sondern zwischen den politischen Parteien. Zwischen den Demokraten und Republikanern. Er sagte, es war ein Krieg, der schon lange vorherzusehen gewesen war. Über die letzten hundert Jahre, sagte er, hätte sich Amerika in zwei Nationen gespalten: Die ganz Rechten und die ganz Linken. Im Laufe der Zeit hätten sich die Positionen so verhärtet, dass es ein Land der entgegengesetzten Ideologien wurde.
Mein Vater sagte, dass die Linken, die Demokraten, eine Nation wollten, die von einer immer größeren Regierung geführt wurde, einer, die die Steuern auf 70 % erhöhte, und sich in alle Aspekte des Lebens der Menschen einbringen konnte. Er sagte, die Rechten, die Republikaner, hätten eine kleinere und kleinere Regierung gewollt, eine, die Steuern ganz abschaffte, sich aus dem Leben der Leute heraushielt und ihnen ermöglichte, selbst für sich zu sorgen. Mein Vater sagte, im Laufe der Zeit wären diese beiden unterschiedlichen Ideologien, statt sich einander anzunähern, noch weiter auseinander gedriftet, noch extremer geworden – bis zu dem Punkt, an dem nichts mehr ging.
Was die Situation noch schlimmer machte, sagte er, war, dass Amerika so überbevölkert war, dass es für jeden Politiker schwieriger wurde, landesweite Aufmerksamkeit zu bekommen, und die Politiker in beiden Parteien begann zu erkennen, dass extremen Positionen die einzige Möglichkeit waren, nationale Sendezeit zu bekommen – die sie für ihren persönlichen Ehrgeiz brauchten.
Daher waren die prominentesten Menschen aus beiden Parteien die extremsten, die jeweils versuchten, die anderen auszustechen. Sie nahmen Positionen ein, an die sie selbst gar nicht wirklich glaubten, die sie aber einnehmen mussten, weil sie in eine Ecke gedrängt waren. Natürlich konnten die beiden Parteien, wenn sie diskutierten, nur aneinandergeraten – und die Auseinandersetzungen wurden heftiger und heftiger. Zunächst waren es nur Beschimpfungen und persönliche Angriffe. Aber im Laufe der Zeit eskalierte die verbale Kriegsführung. Und dann, eines Tages, wurde eine Grenze überschritten.
Eines Tages vor über zehn Jahren, kam es zum heiklen Punkt, als ein politischer Führer einem andere mit dem tödlichen Wort drohte: „Sezession“. Wenn die Demokraten versuchten, die Steuern auch nur noch um einen Cent zu erhöhen, würde seine Partei sich von der Union abspalten, und jedes Dorf, jede Stadt, jeder Staat würde sich zweiteilen. Nicht nach Land, sondern nach Ideologie.
Sein Timing hätte nicht schlimmer sein können: Zu dieser Zeit befand sich die Nation in einer wirtschaftlichen Depression, und es gab genug Unzufriedene, die ihren Job verloren hatten, so dass er schnell an Beliebtheit gewann. Die Medien liebten die Bewertungen, die er bekam, und sie gaben ihm mehr und mehr Sendezeit. Seine Popularität wuchs. Da niemand ihn aufhielt und die Demokraten keine Kompromisse eingehen wollten, kam die Sache in Schwung und seine Idee manifestierte sich. Seine Partei schlug eine eigene Flagge für die Nation vor, sogar eine eigene Währung.
Das war der erste Wendepunkt. Wenn jemand aufgestanden wäre und ihn damals aufgehalten hätte, hätte vielleicht alles aufgehört. Aber keiner hielt ihn auf. Also eiferte er weiter.
Mutiger geworden, schlug dieser Politiker vor, die neue Union sollte auch eine eigene Polizei haben, eigene Gerichte, eigene Landespolizisten – und ein eigenes Militär. Das war der zweite Wendepunkt.
Wenn der demokratische Präsident zu der Zeit ein guter Anführer gewesen wäre, hätte er die Dinge damals aufgehalten. Aber machte die Situation durch eine schlechte Entscheidung nach der anderen noch schlimmer. Anstatt die Dinge zu beruhigen und sich um die wichtigsten Bedürfnisse der Menschen zu kümmern, ihre Unzufriedenheit, beschloss er, dass es nur einen Weg gab, die „Rebellion“ niederzuschlagen, auf die harte Tour: Er warf der gesamten republikanischen Führung Volksverhetzung vor. Er rief das Kriegsrecht aus, und mitten in der Nacht ließ er alle festnehmen.
Die Dinge eskalierten, und die gesamte Partei stellte sich hinter ihren Anführer. Auch die halbe Armee stellte sich hinter ihn. Die Menschen wurden aufgeteilt, in jedes Haus, in jeder Stadt, in allen Militärbaracken. Langsam baute sich die Spannung auf den Straßen auf, und Nachbarn hassten Nachbarn. Sogar Familien wurden getrennt.
Eines Nachts folgte die militärische Führung, die hinter den Republikanern stand, geheimen Anordnungen und initiierten einen Staatsstreich, bei dem sie ihre Anführer aus dem Gefängnis befreiten. Es war eine Pattsituation. Und auf den Stufen des Kapitols wurde der erste verhängnisvolle Schuss abgefeuert. Ein junger Soldat dachte, er würde einen Polizisten sehen, der seine Waffe zog, und schoss zuerst. Als der erste Schuss gefallen war, gab es kein Zurück mehr. Die letzte Grenze war überschritten worden. Ein Amerikaner hatte einen Amerikaner getötet. Ein Feuergefecht gefolgt, Dutzenden von Polizisten starben. Die republikanischen Anführer wurden an einen geheimen Ort gebracht. Von dem Moment an war das Militär in zwei Lager gespalten. Die Regierung war in zwei Lager gespalten. Städte, Dörfer, Gemeinden und Staaten, alle in zwei Lager gespalten. Diese Zeit wurde als die Erste Welle bekannt.
In den ersten Tagen bemühten sich Krisenmanager und Regierungsfraktionen verzweifelt, Frieden zu machen. Aber es war zu wenig, zu spät. Nichts konnte den nächsten Sturm verhindern. Eine Gruppe wucherischer Generäle nahm die Zügel in die Hand, weil sie den Ruhm wollten, weil sie die Ersten im Krieg sein wollten, weil sie den Vorteil von Geschwindigkeit und Überraschung wollten. Sie gingen davon aus, dass die ganze Sache sich am besten beenden ließ, indem man die Opposition sofort ausschaltete.
Der Krieg begann. Schlachten auf amerikanischem Boden folgten. Pittsburgh wurde das neue Gettysburg, mir zweihunderttausend Toten in einer Woche. Panzer wurden gegen Panzer mobil gemacht. Flugzeuge gegen Flugzeuge. Jeden Tag, jede Woche eskalierte die Gewalt. Linien wurden im Sand gezogen, Militär und Polizei waren geteilt, und die Kämpfe weiteten sich auf alle Staaten der Nation aus. Überall, jeder kämpfte gegen jeden anderen, Freund gegen Freund, Bruder gegen Bruder. Es kam an einen Punkt, an dem niemand mehr wusste, weshalb man eigentlich kämpfte. Die ganze Nation wurde in Blut ertränkt, und niemand schien dem ein Ende bereiten zu können. Diese Zeit wurde als die Zweite Welle bekannt.
Bis zu diesem Zeitpunkt, schlimm, wie es war, war es immer noch konventionelle Kriegsführung. Aber dann kam die Dritte Welle, die schlimmste von allen. Der Präsident, der verzweifelt von einem geheimen Bunker aus operierte, beschloss, dass es nur einen Weg gab, um das zu unterdrücken, was er weiterhin hartnäckig als die „Rebellion“ bezeichnete. Er rief seine besten Offiziere der Streitkräfte zusammen. Sie rieten ihm, die stärksten Waffen zu nutzen, die er hatte, um die Rebellion ein für alle Mal zu beenden: Er sollte Nuklearraketen ausrichten. Der Präsident stimmte zu.
Am nächsten Tag wurden nukleare Sprengladungen über strategischen Hochburgen der Republikaner in ganz Amerika abgeworfen. Hunderttausende starben an diesem Tag, an Orten wie Nevada, Texas, Mississippi. Millionen starben am zweiten.
Die Republikaner reagierten. Sie griffen zu ihren eigenen Waffen, griffen aus dem Hinterhalt mit NORAD an und warfen ihre eigenen nuklearen Sprengladungen über demokratischen Hochburgen ab. Staaten wie Maine und New Hampshire wurden größtenteils zerstört. Innerhalb der nächsten zehn Tage wurde fast ganz Amerika zerstört, eine Stadt nach der anderen. Es gab Welle auf Welle der schieren Verwüstung, und die, die nicht direkt bei den Angriffen starben, starben kurz danach am Gift in der Luft und im Wasser. Innerhalb von einem Monat war praktisch niemand mehr übrig, der kämpfen konnte. Die Straßen und Gebäude leerten sich, als die verbliebenen Menschen gegen ihre ehemaligen Nachbarn kämpften.
Aber mein Vater hat nicht einmal auf die Einberufung gewartet – deshalb hasse ich ihn. Er war schon lange zuvor gegangen. Vor dieser ganzen Geschichte war er zwanzig Jahre lang ein Offizier im Marine Corps gewesen, und er hatte das alles früher als die meisten kommen sehen. Jedes Mal, wenn er die Nachrichten schaute, jedes Mal, wenn er sah, wie sich zwei Politiker respektlos anschrien, immer noch eins draufsetzten, schüttelte mein Vater seinen Kopf und sagte: „Das wird zum Krieg führen. Glaub mir.“
Und er hatte Recht. Ironischerweise hatte mein Vater seine Zeit abgedient und war schon Jahre vor diesen Ereignissen aus dem Corps ausgeschieden. Aber am Tag, als der erste Schuss fiel, ließ er sich erneut einziehen. Noch bevor überhaupt die Rede von einem wirklichen Krieg war. Wahrscheinlich war der allererste Freiwillige für einen Krieg, der noch nicht einmal begonnen hatte.
Und deshalb bin ich immer noch wütend auf ihn. Warum musste er das tun? Warum konnte er es nicht einfach belassen, dass sie sich alle gegenseitig umbrachten? Warum konnte er nicht zu Hause bleiben und uns beschützen? Warum war ihm sein Land wichtiger als seine Familie?
Ich erinnere mich noch lebhaft an den Tag, an dem er uns verlassen hat. Ich kam an dem Tag aus der Schule nach Hause, und noch bevor ich die Tür öffnete, hörte ich Schreie von drinnen. Ich riss mich zusammen. Ich hasste es, wenn Mama und Papa sich stritten, was eigentlich die ganze Zeit der Fall war, und dachte, es wäre nur ein weiterer Streit.
Ich öffnete die Tür und wusste sofort, dass es dies Mal anders war. Etwas war ganz, ganz verkehrt. Mein Vater stand in voller Uniform da. Das machte keinen Sinn. Er hatte seine Uniform jahrelang nicht getragen. Warum sollte er sie jetzt tragen?
„Du bist kein Mann!“, brüllte meine Mutter ihn an. „Du bist ein Feigling! Du verlässt Deine Familie. Wozu? Um unschuldige Menschen zu töten?“
Das Gesicht meines Vaters wurde rot, wie immer, wenn er zornig war.
„Du hast keine Ahnung, wovon Du redest!“, schrie er zurück. „Ich tue meine Pflicht für mein Land. Das ist auf jeden Fall das Richtige.“
„Das Richtige für wen?”, zischte sie zurück. „Du weißt nicht einmal, wofür Du kämpfst. Für einen dummen Haufen Politiker?“
„Ich weiß genau, wofür ich kämpfe: für den Zusammenhalt unserer Nation.“
„Achso, na dann, Verzeihung, Mister America!“, brüllte sie zurück. „Du kannst das drehen und wenden wie Du willst, aber in Wahrheit gehst Du, weil Du mich nicht ertragen kannst. Weil Du nie damit zurechtgekommen bist, normal in einem Haushalt zu leben. Weil Du zu dumm warst, etwas aus Deinem Leben nach dem Korps zu machen. Also springst Du einfach auf und läufst bei der ersten Gelegenheit davon –“
Mein Vater stoppte sie mit einem harten Schlag in das Gesicht. Ich höre das Geräusch immer noch in meinem Kopf.
Ich war entsetzt. Ich hatte noch nie gesehen, dass er Hand an sie gelegt hatte. Ich fühlte, wie mich meine Kraft verließ, als wäre ich selbst geschlagen worden. Ich starrte ihn an und konnte ihn kaum noch erkennen. War das wirklich mein Vater? Ich war so verblüfft, dass ich mein Buch fallen ließt, es landete mit einem dumpfen Aufprall.
Beide drehten sich um und sahen mich an. Wie abgetötet wandte ich mich ab und rannte den Flur entlang in mein Schlafzimmer, ich knallte die Tür hinter mir zu. Ich wusste nicht, wie ich auf all das reagieren sollte und musste einfach weg von ihnen.
Nur wenige Momente später klopfte es leise an meiner Tür.
„Brooke, ich bin es“, sagte mein Vater mit einer lesen, reuevollen Stimme. „Es tut mir leid, dass Du das ansehen musstest. Bitte, lass mich rein.“
„Geh weg!“, brüllte ich zurück.
Ein langes Schweigen folgte. Aber er ging immer noch nicht.
„Brooke, ich muss jetzt gehen. Ich würde Dich gerne ein letztes Mal sehen, bevor ich gehe. Bitte. Komm raus und verabschiede Dich von mir.“
Ich fing an zu weinen.
„Geh weg!“, schnappte ich wieder. Ich war so überwältigt, so wütend auf ihn, weil er meine Mutter geschlagen hatte, und noch wütender, weil er uns verließ. Und tief drinnen hatte ich Angst, dass er nie wiederkommen würde.
„Ich gehe jetzt, Brooke“, sagte er. „Du musst die Tür nicht aufmachen. Aber ich möchte, dass Du weißt, wie sehr ich Dich liebe. Und dass ich immer bei Dir sein werde. Denk daran, Brooke, Du bist die starke. Pass auf diese Familie auf. Ich zähle auf Dich. Pass auf sie „.
Und dann hörte ich die Schritte meines Vaters, wie er ging. Sie wurden leiser und leiser. Nur Momente später hörte ich, wie die Vordertür sich öffnete und dann wieder schloss.
Und dann nichts mehr.
Minuten – es fühlte sich wie Tage an – öffnete ich langsam meine Tür. Ich spürte es schon. Er war weg. Und ich bereute es schon. Ich wünschte, ich hätte mich verabschiedet. Weil ich tief drinnen schon fühlte, dass er nie wiederkommen würde.
Mama saß am Küchentisch und weinte leiste, den Kopf in ihre Hände gelegt. Ich wusste, dass die Dinge sich an diesem Tag dauerhaft verändert hatten, dass sie nie wieder so sein würden wie zuvor – dass sie nie wieder dieselbe sein würde. Und ich auch nicht.
Und ich hatte Recht. Wie ich jetzt hier sitze und in die Glut des erlöschenden Feuers sehe, mit schweren Augen, wird mir bewusst, das seit diesem Tag nichts mehr jemals wieder war wie zuvor.
*
Ich stehe hier in unserer alten Wohnung in Manhattan. Ich weiß nicht, warum ich hier tue oder wie ich hierher gekommen bin. Nichts scheint einen Sinn zu machen, weil die Wohnung ganz und gar nicht so ist, wie ich sie in Erinnerung habe. Es stehen absolut keine Möbel mehr darin, als hätten wir nie dort gelebt. Ich bin die Einzige hier.
Plötzlich klopft es an der Tür, und herein kommt mein Vater, in voller Uniform, er trägt eine Aktentasche. Seine Augen wirken leer, als wäre er gerade durch die Hölle und zurück gegangen.
„Papa!“ Ich versuche zu schreien. Aber die Worte kommen nicht heraus. Ich sehe nach unten und erkenne, dass ich am Boden festgeklebt bin, hinter einer Wand, und er mich nicht sehen kann. Wie sehr ich mich auch bemühe, mich zu befreien, zu ihm zu rennen, seinen Namen zu rufen, ich kann nicht. Ich bin gezwungen, hilflos zuzusehen, wie er durch die leere Wohnung geht und sich überall umsieht.
„Brooke?“, ruft er aus. „Bist Du hier? Ist irgendjemand zu Hause?“
Ich versuche wieder, zu antworten, aber meine Stimme versagt. Er sucht in jedem Zimmer.
„Ich habe doch gesagt, ich komme zurück“, sagt er. „Warum hat denn niemand auf mich gewartet?“
Dann bricht er in Tränen aus.
Mein Herz bricht, und ich versuche mit aller Kraft, zu ihm zu rufen. Aber wie sehr ich es auch versuche, nichts kommt heraus.
Schließlich wendet er sich ab und verlässt die Wohnung, vorsichtig schließt er die Tür hinter sich. Das Klicken des Griffs hallt in der Leere nach.
„PAPA!“ Ich schreie, endlich ist meine Stimme wieder da.
Aber es ist zu spät. Ich weiß, dass er für immer weg ist, und es irgendwie alles meine Schuld.
Ich blinzele, und das Nächste, was ich weiß, ist, dass ich wieder zurück in den Bergen bin, in Papas Haus, ich sitze in seinem Lieblingssessel neben dem Feuer. Papa sitzt auf der Couch, lehnt sich nach vorne, mit dem Kopf nach unten, und spielt mit seinem Messer vom Marine Corps. Ich bin entsetzt, als ich bemerke, dass die Hälfte seines Gesichtes weggeschmolzen ist, bis auf die Knochen; ich kann tatsächlich die Hälfte seines Schädels sehen.
Er sieht zu mir hoch, und ich habe Angst.
„Du kannst Dich nicht für immer hier verstecken, Brooke“, sagt er, in einem ruhigen Ton. „Du denkst, Du wärst hier sicher. Aber sie werden Dich holen kommen. Nimm Bree und versteck Dich.“
Er steht auf, kommt zu mir herüber, greift mich an den Schultern und schüttelt mich, seine Augen brennen vor Intensität. „HAST DU MICH GEHÖRT, SOLDAT?!“, schreit er.
Er verschwindet, und zugleich werden alle Türen und Fenster geöffnet, in eine Kakophonie aus splitterndem Glas.
Und in unser Haus stürmen ein Dutzend Sklaventreiber mit gezogenen Gewehren. Gekleidet in ihre gänzliche schwarzen Uniformen, ihr Markenzeichen, von Kopf bis Fuß, mit schwarzen Atemschutzmasken, rasen sie durch jeden Winkel des Hauses. Einer von ihnen greift Bree von der Couch und trägt sie mit sich fort, schreiend, während ein anderer direkt auf mich zuläuft, seine Finger in meinen Arm krallt und seine Pistole direkt auf mein Gesicht richtet.
Er drückt ab.
Ich erwachse, schreiend.
Ich fühle, wie sich tatsächlich Finger in meinen Arm krallen und in der Verwirrung zwischen meinem Traum und der Wirklichkeit bin ich bin bereit, zuzuschlagen. Aber als ich aufsehe, ist es Bree, die dort steht und meinen Arm schüttelt.
Ich sitze immer noch in Papas Stuhl, und das Zimmer ist mit Sonnenlicht durchflutet. Bree weint hysterisch.
Ich muss mehrmals blinzeln, während ich mich aufsetze und versuche, mich wieder zurechtzufinden. War das alles nur ein Traum? Es hat sich so real angefühlt.
„Ich hatte einen fürchterlichen Traum!“ Bree weint und hält immer noch meinen Arm fest.
Ich sehe herüber, sehe, dass das Feuer längst ausgegangen ist. Dann sehe ich das helle Sonnenlicht und erkenne, dass es spät am Vormittag sein muss. Ich kann nicht glauben, dass ich in dem Stuhl eingeschlafen bin – das ist mir noch nie passiert.
Ich schüttele meinen Kopf, um die gefühlten Spinnweben herauszubekommen. Der Traum hat sich so real angefühlt, es fällt mir immer noch schwer zu glauben, dass das nicht passiert ist. Ich habe vorher schon oft von meinem Vater geträumt, aber noch nie etwas mit dieser Unmittelbarkeit. Es fällt mir schwer zu glauben, dass er nicht immer noch bei mir im Zimmer ist, und ich sehe mich wieder im Raum um, um sicher zu gehen.
Bree hält sich immer noch untröstlich an meinem Arm fest. Ich habe sie noch nie so gesehen.
Ich knie mich hin und umarme sie. Sie klammert sich an mich.
„Ich habe geträumt, dass diese gemeinen Männer gekommen sind und mich mitgenommen haben! Und Du warst nicht hier, um mich zu retten!“ Bree weint in meine Schulter hinein. „Geh nicht!“, fleht sie hysterisch. „Bitte, geh nicht. Verlass mich nicht!“
„Ich gehe nirgendwohin“, sage ich und umarme sie fest. „Schschsch … Es ist in Ordnung… Du musst Dir keine Sorgen machen. Es ist alles in Ordnung.“
Aber tief drinnen kann ich nicht anders, als das Gefühl zu haben, dass nicht alles in Ordnung ist. Im Gegenteil. Mein Traum verstört mich wirklich, und dass Bree auch so einen schlechten Traum hatte – über Dasselbe – tröstet mich nicht gerade. Ich glaube nicht an Omen, aber ich kann mir nicht helfen, ich frage mich, ob das alles ein Zeichen ist. Andererseits höre ich kein Geräusch und spüre keine Bewegung, und wenn da irgendjemand auch nur einen Kilometer entfernt wäre, wüsste ich das sicherlich.
Ich hebe Brees Kinn hoch, wischen ihre Tränen weg. „Atme mal tief durch“, sage ich.
Bree hört zu, langsam bekommt sie wieder Luft. Ich zwinge mich, zu lächeln. „Siehst Du“, sage ich. „Ich bin doch hier. Alles ist in Ordnung. Es war nur ein schlechter Traum. Okay?“
Langsam nickt Bree.
„Du bist nur übermüdet“, sage ich. „Und Du hast Fieber. Deswegen hast Du schlechte Träume. Es wird alles in Ordnung sein.“
Бесплатно
Читать книгу: «Arena Eins: Die Sklaventreiber »
Установите приложение, чтобы читать эту книгу бесплатно
О проекте
О подписке